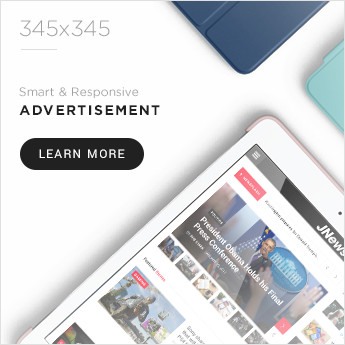Alles so schön bunt hier! Tests gehören längst zum Standard im Karriere- und Businesscoaching. Sie geben Struktur, schaffen eine gemeinsame Sprache für Unterschiede. Doch leider vermitteln sie oft eine trügerische Objektivität. Nur ein Bruchteil der Verfahren erfüllt die wissenschaftlichen Standards der Psychologie. Genau diese Tools sind in der Praxis jedoch häufig weniger populär — ganz anders als die “Bunten”. Schauen wir uns typischen Fallbeispiele an.
Praktische Empfehlungen rund um Tests für Coaches
Den Test einordnen
Ein Coach sollte in der Lage sein, das von ihm selbst eingesetzte Instrument kritisch einzuordnen. Dazu gehört es, die psychometrische Qualität zu verstehen. Es kann hilfreich sein, die eigenen Kenntnisse in Testtheorie aufzufrischen.
Eine praxisnahe Einführung bietet mein Seminar „Psychologie der Veränderung“. Tests sind nur dann sinnvoll, wenn eine qualifizierte Einzelauswertung möglich ist – durch Personen, die sowohl psychologische Grundlagen als auch die individuellen Dynamiken verstehen.
Sich als Coach die richtigen Fragen stellen
- Kann ich eine fundierte individuelle Auswertung anbieten?
- Besteht bei diesem Klienten die Gefahr, dass das Ergebnis als Etikett missverstanden wird?
- Fördert der Test wirklich das Ziel des Coachings oder gibt es andere, passendere Methoden?
- Wie mache ich transparent, dass Tests keine Wahrheiten liefern, sondern Impulse für Reflexion?
- Erfolgt die Entscheidung zur Nutzung freiwillig durch die Klientin oder den Klienten?
Verliebt in das Ergebnis? Vorsicht, Barnum!
Jonas ist begeistert: „Das passt total zu mir.“ Doch Begeisterung bedeutet nicht automatisch wissenschaftliche Qualität. Häufig spiegeln solche Tests lediglich allgemeingültige Aussagen, die fast jeder auf sich beziehen könnte – ein Beispiel für den Barnum-Effekt. Dieser besagt, dass man sich jeder in Allgemeinplätzen wiederfinden kann. Ähnlich wie im Horoskop.
Lara kann die Energie ihres Coachees nutzen: Wenn er sich durch den Test inspiriert fühlt, ist das ein guter Einstieg, um über seine Stärken, Bedürfnisse und Ziele ins Gespräch zu kommen. Gleichzeitig sollte sie behutsam auf stereotype Zuschreibungen achten und den Blick immer wieder auf die individuelle Wirklichkeitskonstruktion und Entwicklungsmöglichkeiten lenken.
Wissenschaftliche Standards im Blick
Persönlichkeitstests sind Landkarten – nie die Landschaft selbst. Idealerweise sind es gute Landkarten, die auch wirkliche Aussagen zulassen. Sie können Orientierung geben, müssen aber auf soliden wissenschaftlichen Kriterien basieren: Reliabilität (Zuverlässigkeit), Validität (misst das Verfahren wirklich, was es zu messen vorgibt) und Objektivität (Unabhängigkeit von Auswertenden). Viele populäre Typentests und manche kommerziellen Verfahren erfüllen diese Bedingungen nicht.
Das international am besten validierte Modell ist seit Jahrzehnten das Big-Five-Modell. Es beschreibt Persönlichkeit differenziert anhand der Dimensionen Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus – jeweils mit mehreren Unterfacetten. Dadurch wird sichtbar, dass Menschen nicht einfach „introvertiert“ oder „extrovertiert“ sind, sondern sich auf einem Kontinuum bewegen.
Ein daraus entwickeltes Instrument ist der LINC Personality Profiler (LPP). Er basiert auf dem Big-Five-Modell, arbeitet mit einer modernen, anschaulichen Darstellung und bietet auch Optionen für Coaching-Feedbackgespräche. In der aktuellen RAUEN-Marktanalyse 2024 wird der LPP als führendes Persönlichkeitsverfahren im deutschsprachigen Coaching-Markt benannt. Anerkannt ist auch das von Prof. Rüdiger Hossiep an der Ruhr-Universität Bochum entwickelte „Bochumer Inventar“, das sich speziell an Nicht-Psychologen richtet.
Was soll der Test eigentlich leisten?
Auch empirisch besser abgesicherte Verfahren – etwa das CliftonStrengths-Modell – haben Grenzen und blindem Flecken. Stärkenprofile spiegeln häufig Prägungen der Vergangenheit, ohne unbedingt die Entwicklungsrichtung in die Zukunft zu zeigen. Für manche Coaching-Themen ist es daher hilfreicher, mit Ansätzen wie den Charakterstärken aus der Positiven Psychologie zu arbeiten, die stärker auf Ressourcen und Sinnorientierung fokussieren.
Die entscheidende Frage für jede Coachingsitzung aber bleibt: Wozu setze ich den Test ein? Geht es nur darum, ein Gespräch in Gang zu bringen, dann reicht oft schon ein Modell oder eine Reflexionsübung. Geht es um tieferes Selbstverständnis, Entwicklungsziele oder Passung, dann sollte man ein wissenschaftlich fundiertes Instrument wählen – und die Ergebnisse gemeinsam kritisch reflektieren. Dabei kann es sinnvoll sein, den Blick auf die vertikale Entwicklung zu lenken, wie sie sich in der Ich-Entwicklung spiegelt. Diese wird mit einem projektiven Verfahren namens Washington University Sentence Completion Test (WUSCT) gemessen
Stehen konkrete Berufsempfehlungen im Mittelpunkt, braucht das Verfahren Hand und Fuß – und vor allem ausreichend Daten. Hier empfehlen sich der RIASEC und wieder die Big Five. Auch bei jungen Klient:innen sind solide Tests hilfreich, da sie noch nicht auf so viel Erfahrung zurückgreifen können. Hier empfehlen sich zusätzlich oft auch kognitive Leistungstests. Erst recht gilt das, wenn wichtige Berufs- und Studienentscheidungen anstehen.
In meiner Praxis erlebe ich oft, dass Coaches in ein Dilemma geraten, weil sie mit Kundenpräferenzen konfrontiert werden. Lara etwa arbeitet als Business Coach. Eigentlich weiß sie, dass der klassische Farbtypen-Test namens DISG oder DISC wissenschaftlich nicht haltbar ist. Doch ihr Coachee Jonas hat ihn gemacht und ist begeistert von den Ergebnissen. Nun erwartet er, dass die beiden damit weiterarbeiten. Was tun?
Kann und will ich mich darauf einlassen?
Lara sollte prüfen, ob Jonas’ Anliegen wirklich die Arbeit mit einem Test erfordert. Ob es nicht hilfreicher wäre zu signalisieren, dass sie die Ergebnisse lieber nicht einbeziehen möchte, um nicht voreingenommen zu sein.
Ein anderer Fall: Markus ist Coach und Führungskräftetrainer. Das Unternehmen bittet ihn, den bekannten Tests Insights einzusetzen, weil ihre Personalabteilung damit gute Erfahrungen gemacht habe. Markus weiß, dass der Test wissenschaftlich umstritten ist. Wie sollte er reagieren?
Eine eigene Haltung entwickeln
Markus sollte sich fragen: Kann ich zum Einsatz dieses Tests stehen? Kann ich ihn gegebenenfalls eine Art Hintergrundfolie nutzen und dazu beitragen, dass die Teilnehmenden sich produktiv und kritisch mit dem Ergebnis auseinandersetzen. Andernfalls drohen Missverständnisse oder unzulässige Etikettierungen.
Wichtig ist das auch, wenn ein Unternehmen Tests missbräuchlich einsetzt, etwa um unter dem Etikett der Stärkenorientierung zu stereotypisieren. Noch schlimmer: Um Eignung für Jobprofile daraus herzuleiten. Das kann leicht passieren, wenn nur in Gruppen gearbeitet wird und Testauswertung und kritische Einordnung kaum Raum bekommen.
Geht es auch ohne Test?
Oft lässt sich Selbstreflexion auch ohne Test anregen, zum Beispiel durch Fragen oder Methoden wie das Wertequadrat, das Zürcher Ressourcen Modell oder meinen StärkenNavigator. Oft kann ein Test aber auch schnell auf den Punkt bringen, was man sonst lange erfragen müsste – jedenfalls ein guter. Am Ende ist es eine Fallentscheidung. Wichtig isr nur eins: Machen Sie sich nicht abhängig von einem Verfahren, sondern orientieren Sie sich an dem, was dem Klienten wirklich nützt.
Wer mehr dazu wissen möchte, sollte sich meine Masterclass für Stärkencoaching anschauen.
Der Beitrag Tests im Coaching: Vorsicht, Farbe! erschien zuerst auf Svenja Hofert.