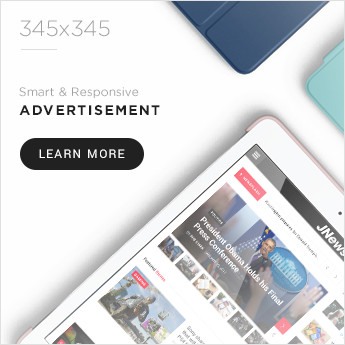Laufen lernen
Alles begann mit dem Tag, an dem ich laufen lernte. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Das ist bestimmt ziemlich lange her, außerdem ist der Beginn lahm, weil ihr mich noch gar nicht kennt. Also nicht ganz. Ihr wisst schon, dass ich schreibe. Und dass der Beginn lahm ist, wenn ihr mir glaubt. Aber wenn ihr mir glaubt, ist das auch wieder gut, denn deshalb schreibe ich den Text.
Es geht also nicht ums wirkliche Laufen, sondern es ist so ein Bild, das gute Autoren nebenbei entwickeln. Und schlechte einem auf die Nase binden. Das ist schon ironisch, oder? Jedenfalls begann da alles, was jetzt passierte. Im übertragenen Sinne.
Es ist schon ein wenig so wie bei kleinen Kindern, die erst zu einen Seite und dann zur anderen Rollen und alle anderen sehen das und denken sich nichts dabei und die Augen der Eltern laufen über, weil es die wunderbarste Bewegung ist, die sie je gesehen haben, bis dann das wirkliche Laufen kommt. Also dieser Moment, wo man bei dem kleinen Ding sieht, dass es nun allen um ihn herum nacheifern will. Es ist kein Blick zu dem Gehenden, sondern es ist schon ein eingeprägter Bewegungsablauf, der nur noch nicht konkret wurde. Der Blick geht auf den Boden, manchmal bis zu den Knien, und dann schupsen die Hände den Körper nach oben. Meistens geht es dann noch nicht, sondern der Körper schwankt, vielleicht ist es dann nur ein kleiner Schritt, und zack, sitzt der Kurze auf dem Hintern.
Das Zauberhafte an dem Moment ist nicht nur, dass der junge Mensch mit diesem unwahrscheinlichen Akt der Anstrengung zur Gruppe der Gehenden hinzustößt, sondern dass er der Schwerkraft mithilfe seines Körpers trotzt. Das Gehen wird zur Emanzipation gegenüber der Natur. Der Kopf ist oben und der Mensch muss sich anstrengen, wieder zurückzublicken.
An dem Tag, an dem ich laufen lernte, war das nicht ein solches Gehen. Es hatte auch gar nicht mit den Beinen zu tun, weshalb ich zu Anfang von dem Bild gesprochen habe. Aber etwas in mir sträubt sich, das jetzt alles zu erklären, denn dann wäre es ein so spezielles Laufen, das alle, die den Text lesen, denken: Dieses Laufen ist nur dein Laufen, also kann ich mit dem Laufen nichts anfangen. Und am Ende gibt es einen Spruch auf einem Monat in einem Kalender oder ein kurzes Video, das jemand in wenigen Sekunden aufnimmt und meint, nun hätte er mein Laufen verstanden.
Nein, dagegen sträube ich mich.
Auch wenn ich verstehen kann, dass, wenn jemand gezwungen würde, und das ist zum Beispiel in der Schule der Fall, junge Leserinnen und Leser schon allen wegen eines solchen Satzes die Wut bekommen, abschalten oder kaum an sich halten können würden zu fordern, dass der Autor des Textes endlich das Laufen nennt, mit dem alles begann.
Und dann haben wir noch nicht einmal über das gesprochen, was in diesem Satz „alles“ heißt.
Ich verstehe das.
Aber ich habe da schlechte Nachrichten. Denn das Laufen, was ich meine, ist zwar meines, aber es könnte auch deines sein. Dann nämlich, wenn du es zu deinem machst. Und man merkt schon, hier wird es entweder tiefgründig oder oberflächlich, je nachdem, in welcher Verfassung man es hierhin geschafft hat.
„Alles begann mit dem Tag, an dem ich laufen lernte.“ Zufrieden schaute er auf seinen Schreibtisch. Das Glas war leer, die Wasserflasche daneben auch. Das helle Licht der Schreibtischlampe wurde in leicht abgetönter, konischer Form auf den weißen Grund geworfen. Es klapperte nicht mehr. Er war zufrieden, weil er einen Satz geschrieben hatte. Dieser Satz würde für einige Zeit reichen. Man darf es nicht überstürzen, um sich selbst nicht zu überfordern, zu viel zu wollen und zu wenig zu schaffen. Er stand auf und ging zum Regal. Von hier aus sah die Tastatur aus wie ein kleines Klavier. Morgen würde er den nächsten Satz versuchen. Einen, in dem es darum ging, was der Autor damit meinte, laufen gelernt zu haben