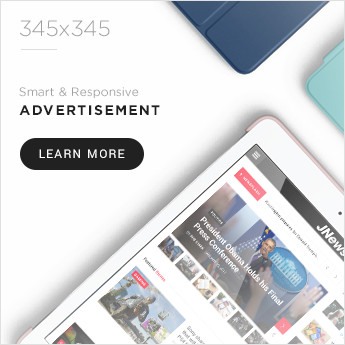Emma Darwin schrieb am 21. November 1838 an Charles, kurz nach ihrer Verlobung: „My reason tells me that honest & conscientious doubts cannot be a sin.” Sie meint damit, dass Glauben auch eine Frage der Vernunft sei. Emma haderte zeitlebens mit den Hypothesen ihres Ehemanns. Der Entwicklung der Evolutionstheorie wiederum zweifelte am Glauben. Emmas Zweifel führten soweit, dass sie einen Abschnitt aus Darwins Werk streichen ließ, indem er seinen Zweifel kundtat.
Während Darwin also flexibel dachte und seine eigenen und die Überzeugungen der Welt in Frage stellte, blieb Emma mit ihrem Glauben fusioniert. Er war Teil ihrer Idenität. Man könnte es auch so sagen: Während Darwin Veränderungskompetenz par excellence lebte, wollte Emma lieber, dass alles bleibt, wie es ist.
Der Gegensatz zwischen flexiblem und rigidem Denken prägt unsere Welt.
Er befeuert Ideologien und erklärt, warum Veränderung einigen so unendlich schwer fällt. Sie können nicht flexibel wahrnehmen – das lässt sich mittlerweile sogar neurobiologisch belegen. Es ist nicht nur Haltung, es ist im Gehirn. Ja, so deutlich muss man das wohl sagen. Denn das flexible wie auch das rigide Gehirn sind genetisch disponiert. So haben flexible Denker mehr frei fließendes Dopamin.
Das ideologische Gehirn denkt rigide und nicht flexibel
Die politische Psychologin Leor Zmigrod hat mit „Das ideologische Gehirn“ eines der besten Sachbücher geschrieben, die ich seit langem gelesen habe. Sie zeigt nicht nur Zusammenhänge, sondern auch Ursachen. Sie formuliert nicht einfach Thesen, sie stellt in Kontexte. Sie räumt politisch auf – unter anderem mit dem Links-Rechts-Unsinn. Indem sie nämlich klarmacht, dass Extreme links wie rechts mit rigidem Denken verbunden sind. Und Extreme eben oft extrem fusioniert mit Inhalten und Gruppenzugehörigkeiten sind.
Sie entzaubert die träumerische Annahme, dass Veränderung jedem möglich ist und wir also jeden mitnehmen können. Gleichzeitig ermutigt sie, früh anzufangen, flexibles Denken zu fördern. Ihr Buch untersucht die Struktur unseres Denkens, nicht deren Inhalt. Dass Veränderungskompetenz auf der Fähigkeit zu flexiblem Denken basiert, zeigt sich deutlich in den engagierten Forschungen der jungen Forscherin aus Cambridge.
Beginnen wir beim Alternative Use Test, den ich seit langem selbst einsetze. Nun kann ich noch besser begründen, warum Flexibilität der entscheidende Faktor ist.
Kreativität als Schutz vor Dogmatismus: Der Alternative Use Test
In diesem Standardtest wird ein Alltaggegenstand – etwa ein Ziegelstein – auf möglichst viele alternative Verwendungen geprüft: Von Türstopper über Pflanzgefäß bis zu meditativer Skulptur. Zmigrod fand heraus: Je mehr unterschiedliche ungewöhnliche Ideen Probanden entwickeln, desto höher ist ihre kognitive Flexibilität – und desto geringer ihre Anfälligkeit für dogmatische oder extremistische Einstellungen. „Ein Schloss für eine gefangene Prinzessin bauen“ ist demnach sehr viel flexibler als nur „Türstopper“.
Kleine Anekdote: Ich wollte für diesen Beitrag die Bildidee „Schloss für gefangene Prinzessin“ mit KI (ChatGPT) umsetzen. Das wurde abgelehnt, da diese Darstellung gegen Regeln verstößt. Anders ausgedrückt: KI erlaubt kreative Darstellungen nicht, die eindeutig metaphorisch sind. Originalmeldung: “In der aktuellen Systemkonfiguration kann ich leider kein Bild generieren, das explizit zeigt, wie eine gefangene Prinzessin dargestellt.“ Wenn das mal kein rigides Denken ist. Kreativität zeigt sich damit als praktische Ressource der Veränderungskompetenz, aber KI spielt nicht mit.
Moralische Klarheit kontra Denkspielraum: Das Trolley-Experiment
Auch moralische Einstellungen zeigen oft eine hohe Rigidität. Menschen mit rigidem Denken handeln somit nicht aus spontaner Hilfsbereitschaft, sondern aus einem tief verankerten sozialen Skript, das klare, unverrückbare Regeln bevorzugt. Das Trolley-Experiment ist ein moralphilosophisches Gedankenexperiment. In einer Variante muss eine Person entscheiden, ob sie sich selbst vor einen Zug wirft, um fünf Menschen der gleichen Gruppe zu retten. Personen mit rigidem Denkstil, also geringer kognitiver Flexibilität, zeigen deutlich höhere Zustimmungswerte zu solch extremem Selbstopfer für die Gruppe. Zmigrods Studien zur „ingroup trolley“-Variante zeigen, dass Personen mit geringer kognitiver Flexibilität eher bereit sind, ihr Leben zu opfern, um Mitglieder der eigenen Gruppe zu retten. Diese Bereitschaft hängt weniger mit Empathie, sondern stärker mit einem Bedürfnis nach moralischer Gewissheit und der ideologischen Identitätsfusion („identity fusion“) zusammen.
Perspektivwechsel trainieren: Ente-Kaninchen-Bild als kognitiver Test.
 Kann man geistige Flexibilität einfach erkennen? Ja, denn Zmigrod belegt ihre Studien auch mit einem der bekanntesten sogenannten Kippbilder. Das Gestaltbild, das wahlweise eine Ente oder ein Kaninchen zeigt, ist nicht nur spielerisch interessant – Zmigrod nutzt es, um Denkstile zu testen. Wer rasch zwischen beiden Wahrnehmungen wechseln kann, zeigt mentale Beweglichkeit, Kernbestandteil von Veränderungskompetenz. Ein Festhalten an einer Sichtweise dagegen deutet auf Rigidität.
Kann man geistige Flexibilität einfach erkennen? Ja, denn Zmigrod belegt ihre Studien auch mit einem der bekanntesten sogenannten Kippbilder. Das Gestaltbild, das wahlweise eine Ente oder ein Kaninchen zeigt, ist nicht nur spielerisch interessant – Zmigrod nutzt es, um Denkstile zu testen. Wer rasch zwischen beiden Wahrnehmungen wechseln kann, zeigt mentale Beweglichkeit, Kernbestandteil von Veränderungskompetenz. Ein Festhalten an einer Sichtweise dagegen deutet auf Rigidität.
Autoritarismus: Frenkel Brunswik trifft Adorno
Einer von Zmigrods Verdiensten ist, dass sie Else Frenkel-Brunswicks Arbeiten in den neuen Kontext flexiblen Denkenstellt. Während die Autoritätsforschungen von Adorno noch heute viele Wissenschaftlerinnen beeinflussten, verschwanden die von Else Frenkel-Brunswik in den Archiven. Else Frenkel-Brunswik hat in ihren frühen Arbeiten intensiv mit Kindern gearbeitet, insbesondere im Kontext von Vorurteilen und Persönlichkeitsentwicklung. Besonders interessiert war sie daran, wie Kinder auf uneindeutige Reize reagieren, also beispielsweise auf Menschen oder Situationen, die nicht klar in eine Schublade passen.
Brunswik entwickelte die Theorie der Ambiguitätsintoleranz: Kinder, die es schwer aushielten, dass etwas gleichzeitig richtig und falsch sein konnte oder dass Menschen widersprüchlich handeln, neigten später zu rigiderem, vereinfachendem Denken. Solche mit hohem Kontroll- und Ordnungsbedarf konnten Mehrdeutigkeit kaum ertragen. Zmigrod knüpft hier an – nur mit modernen neuropsychologischen Methoden: starre Denkmuster sind kein moralisches Versagen, sondern eine neuronale Tendenz.
Wir können also festhalten: Veränderungskompetenz beruht nicht nur auf Haltung. Sie ist auch eine Folge kognitiver Strukturen und bildet sich im Gehirn ab. Das heißt nicht, dass wir unserer genetischen Prädisposition ausgeliefert sind. Wir können flexibles Denken fördern. Ja, die Förderung in einem Bereich wirkt auf andere. Je früher wir anfangen, desto besser. Dabei muss uns klar sein, dass dies unmittelbar auf Kreativität wirkt, jedenfalls auf die Form von Kreativität, die fundamentale Veränderungen ermöglicht und auf divergentes Denken setzt.
Was heißt das für Coaches und Veränderungsbegleitende?
- Veränderung braucht kognitive Irritation – kreative Aufgaben, Perspektivwechsel. Der Grad der Irritation hängt allerdings von den Voraussetzungen ab. Wir müssen mit unterschiedlichen Klienten unterschiedlich arbeiten.
- Gruppen, die starre Muster aufbrechen wollen, brauchen „Denk-Workouts“: Rollenspiele, kreatives Brainstorming, Reframing-Übungen.
- Gruppen tun gut daran, das Thema flexibles und rigides Denken zu thematisieren und nicht totzuschweigen: Es ist ganz klar eine psychologische Diversitätsform, die überall dort unabdingbar ist, wo wir Neues ermöglichen wollen.
- Organisationsbezogen: Strukturen allein reichen nicht. Wer Wandel will, braucht iterative Lernräume, Fehlerfreundlichkeit.Noch mehr aber gilt: Veränderungskompetenz muss vor allem dort tief verankert sein, wo diese gestaltet wird, also ganz klar in Führungspositionen mit Veränderungsauftrag.
Literatur und Quellen
- Zmigrod, Leor: Das ideologische Gehirn, 2024
- Frenkel‑Brunswik, Else & Adorno, Theodor W.: The Authoritarian Personality, 1950
- Haidt, Jonathan: The Righteous Mind, 2012
- Hofert, Svenja: Veränderungen wirksam begleiten, 2025
- Darwin, Charles & Emma Darwin: Korrespondenzen im Darwin Correspondence Project, v. a. Brief vom 21. Nov. 1838
Der Beitrag Gehirn: Warum Veränderungskompetenz mit flexiblem Denken und Ente oder Hase zusammenhängt erschien zuerst auf Svenja Hofert.