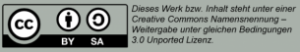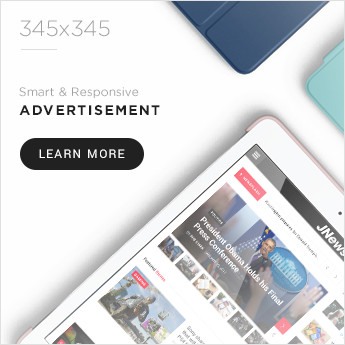Donald Trump twittert gegen das Establishment, Elon Musk inszeniert sich als Rebell gegen „die Eliten“. Beide nutzen die Sprache des Widerstands – und beherrschen die Plattformen, auf denen ursprünglich Protest gegen etablierte Machtsysteme stattfand. Während rechte Bewegungen das Netz längst als Bühne erobert haben, suchen progressive Stimmen nach neuen Wegen, Gehör zu finden. Gesellschaftspolitischer Aktivismus hat sich verändert – ob im Positivem oder Negativem, er wird heute ganz anders praktiziert als noch vor zwanzig Jahren.
Wo früher die Straße der wichtigste Ort für politischen Protest war – ist es heute das Internet. Kampagnen wie #BlackLivesMatter, #Metoo und #FridaysForFuture haben das in den letzten Jahren deutlich bewiesen. Was als simpler Hashtag startet – wird zu mehr: nämlich einer großen politischen und aktivistischen Bewegung. Diese bleibt aber nicht im Internet, sondern verlagert ihren Handlungsspielraum ins echte Leben. Daraus resultieren Demonstrationen, Kundgebungen, Boykotte, etc. Das Erfolgsrezept? – Gekonntes Zusammenspiel von Online-Präsenz und realem aktivistischem Wirken!
Aktivismus ≠ Aktivismus
Zwischen Online-Petitionen, Hashtags und Telegram Chatgruppen hat aktivistisches Engagement seinen Platz im Internet gefunden. Der Begriff dafür: Digitaler Aktivismus – sozusagen alles, was mit der Verbreitung von gesellschaftspolitischen Themen im Netz zu tun hat.
Eine ziemlich breite Definition, dafür umso weniger klare Bedeutung. Denn: Aktivismus ist nicht gleich Aktivismus. Während manche nur passiv Online Inhalte konsumieren und hin und wieder politische Beiträge lesen, mobilisieren die anderen in großen Massen über soziale Medien für Demonstrationen. Das beste Beispiel: die Palästina-Kundgebung in Berlin am 27. September 2025. Zwischen 60 000 und 100 000 Menschen waren auf der Straße – wie sie dorthin gekommen sind? In erster Linie durch extremes Engagement und Werbung auf sozialen Medien der Veranstalter*innen. So sprachen diese in Interviews über ihre mediale Mobilisierung und Aufrufzahlen in einer Höhe von 3,5 Millionen (Quelle: Tagesspiegelberichterstattung über den 27.09 und taz Interview ).
Es gibt verschiedene Arten von digitalem Aktivismus. Zwei eher gegenteilige Formen sind ein gutes Beispiel, um das zu symbolisieren. Etwas bekannter ist der Slacktivismus – oberflächige politische Partizipation durch Liken und Teilen von Posts auf social media Plattformen. Diese Art des digitalen Aktivismus ist charakterisiert durch Oberflächigkeit –sucht man nach tiefgehender politischer Beteiligung im Netz, wird man hier jedoch nicht fündig. Dafür mangelt es an direkten politischen und aktivistischen Konsequenzen, die aus dem besagten digitalen Verhalten resultieren.
Auf der anderen Seite steht virtuelles gemeinschaftliches Handeln. Politisch organisierte Gruppen, die sich die Digitalisierung zu Nutze machen und so online politisieren und mobilisieren. Von Konsument*innen politischer Inhalte zu agierenden Produzent*innen – man kreiert eigene aktivistische Beiträge und spricht damit andere Menschen an.
Und welche Plattformen eignen sich dafür besser als soziale Medien? Digitaler Aktivismus wird durch die Erschaffung eigener politischer Inhalte auf Tiktok, Instagram und Co betrieben. Dort wächst zwischen inhaltslosen Content Aktivismus und Politisierung findet statt.
Die Bandbreite von dem, was als digitaler Aktivismus beschrieben werden kann, ist groß – dessen tatsächlicher Einfluss dafür nicht immer. Reicht das simple Reposten von politischen Beiträgen und Hashtags wirklich aus? Oder sollte man eher sagen: „Raus aus dem Internet und ab auf die Straße?“
Zwischen Einsamkeit und Kollektivismus
Wie sieht es außerdem mit Communities im Netz aus – ist es möglich, online eine Gemeinschaft zu bilden, die sich zusammen für politische Anliegen einsetzt? Oder versinkt man einsam zwischen Hashtags und Algorithmen – mit einem Hauch von dem, was aktivistischen Engagement sein soll?
Die Verbindung von politischen Gruppierungen im Netz birgt Chancen – genauso stellt es aktivistische Protestformen aber auch vor Herausforderungen!
Durch Algorithmen und Echokammern besteht die Gefahr der Vereinsamung. Nur weil man zu demselben Thema, wie viele andere ein Video teilt, einen Hashtag benutzt oder auf etwas aufmerksam macht, bedeutet das noch lange nicht Teil einer aktivistischen kollektiven Masse zu sein. Im Gegenteil: meistens sind es Individuen, die unabhängig voneinander ihren sogenannten Aktivismus betreiben.
Was fehlt, ist der gemeinsame Spirit – der Zusammenhalt für eine Sache. Es braucht die Kollektivität – die vor allem im Austausch miteinander ist. Man lebt, klickt, swiped aneinander vorbei – ohne sich tatsächlich miteinander zusammenzuschließen.
Nur wenn es Einzelpersonen schaffen in Kontakt miteinander zu kommen und sich gemeinsam zu organisieren, können Gruppen im Internet zu einer tatsächlichen aktivistischen Bewegung heranwachsen.
Andersfalls besteht die Gefahr, dass jeder individuell – gefangen auf der eigenen For–you-page politischen Content produziert und / oder konsumiert, sich daraus aber nie eine Community formiert, die echte aktivistische Veränderung erreichen kann.
Politische Gruppen und die Digitalisierung – Online und Offline Aktivismus
Glücklicherweise gibt es nicht nur digitalen Aktivismus. Politische Netzwerke, die die Hürden der Algorithmen und Echokammern überwinden und es schaffen, sich digital zu organisieren, sind mit ihrem Offline-Aktivismus nämlich umso erfolgreicher.
Das eine existiert nicht ohne das andere. Online und Offline Räume sind voneinander abhängig und beeinflussen sich gegenseitig. Für echtes aktivistisches Wirken und dessen Kernarbeit benötigt es fundierte Aktionen abgesehen vom Internet. Eine gute Online-Kampagne ist nur so gut, wie auch ihre aktivistischen Erfolge außerhalb des Netzes! – Immerhin ist der Kampf für gesellschaftspolitische Anliegen auf der Straße ein Kernelement aktivistischen Wirkens. Den Spieß kann man jedoch auch umdrehen, denn: Aktivismus ohne online Präsenz? – Meistens ein Fehlschlag.
Es braucht die Mobilisierung und Aufmerksamkeit im Netz. Die Kombination verschiedener Tools und Methoden ist der Schlüssel zu nachhaltigen und Output reichen Aktivismus. Was das genau in der Praxis bedeutet, zeigen aktuelle aktivistische Bewegungen, die sich für die palästinensische Zivilbevölkerung einsetzen.
Die Global Sumud Flotilla zeigt, wie es geht?
Im Jahr 2025 wurde die international tätige Initiative Global Sumud Flotilla von der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg und dem Enkel Nelson Mandelas, Mandla Mandela gegründet. Die Initiative hat es sich u.a. zum Ziel gemacht, die Blockaden im Gazastreifen zu durchbrechen und den Menschen vor Ort humanitäre Hilfe zu liefern.
Die Global Sumud Flotilla ist längst mehr als ein Hilfsprojekt – sie ist zum Spielball politischer Interessen geworden. Während Unterstützerinnen und Unterstützer sie als Akt zivilen Widerstands feiern, werfen Kritiker der Initiative politische Instrumentalisierung vor. Im Zentrum steht eine heikle Frage: Wie ist die anhaltende Blockade und die Einschränkung humanitärer Hilfe im Gazastreifen zu bewerten? Handelt es sich, wie es Vertreter des Internationalen Strafgerichtshofs andeuten, um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit – oder um eine sicherheitspolitische Maßnahme, wie Israel betont?
Trotz der politischen Brisanz hat die Global Sumud Flotilla nicht nur Aufmerksamkeit erzeugt – sie zeigt, wie digitaler Aktivismus heute funktioniert. Mit täglichen Livestreams, Updates und politischen Statements auf Social-Media-Plattformen wie Instagram inszeniert die Initiative ihre Mission in Echtzeit. Ein Live-Tracker auf der Website verwandelt die Bewegung in ein interaktives Erlebnis: Die Öffentlichkeit kann den Kurs jedes Bootes verfolgen, Anteil nehmen und sich einbringen. Die Reichweite ist enorm – allein auf Instagram folgen rund drei Millionen Menschen, dazu kommen zahlreiche internationale Medien, die die Reise begleiten. Die Flotilla verdeutlicht, wie politische Botschaften durch digitale Sichtbarkeit, partizipative Tools und mediale Begleitung zu globalem Einfluss verdichtet werden – ein Lehrstück dafür, wie Aktivismus im 21. Jahrhundert wirkt.
Was bedeutet das nun folglich für (digitalen) Aktivismus? Die Global Sumud Flotilla zeigt exemplarisch, wie Online und – Offline-Aktivismus heute miteinander verwoben sind. Reine Social-Media-Kampagnen würden wohl kaum mehr erreichen als Aufmerksamkeit für ein Thema zu erzeugen. Umgekehrt hätte die Flotilla als physischer Protest ohne die kontinuierliche, strategische Content-Produktion nicht die enorme symbolische Reichweite und mediale Präsenz, die sie heute besitzt. Online-Posts und reale Aktionen verstärken sich gegenseitig – sie sind untrennbar miteinander verbunden und multiplizieren Wirkung und Einfluss.
Diese Online-Präsenz zivilgesellschaftlicher Initiativen greift direkt in die Politik von Staaten ein und erzeugt öffentlichen Druck. Für Israel stellt sich die Frage: Wie reagieren, wenn möglicherweise ein Viertel der Welt durch die Medien zuschaut?
Zukunft des Aktivismus
Soziale Medien prägen unseren digitalen Alltag wie kaum ein anderes Medium. Gleichzeitig zeigt sich: Die Kluft zwischen digitaler Aufmerksamkeit und realem zivilgesellschaftlichem Handeln ist oft größer als gedacht. Gesellschaftspolitische Initiativen machen das deutlich: Ob Hashtags, Kampagnen oder virale Posts – all das bleibt wirkungslos, wenn ihnen keine konkreten Aktionen im realen Leben folgen. Umgekehrt riskieren politische Gruppen, die auf soziale Medien verzichten, leicht, den Anschluss zu verlieren.
Die Kombination aus Online-Strategie und realem Handeln ist heute entscheidend für erfolgreichen Aktivismus. Wer dies ignoriert, verpasst die Möglichkeit, den gesellschaftlichen Diskurs von morgen aktiv mitzugestalten.
Text: CC-BY-SA 3.0