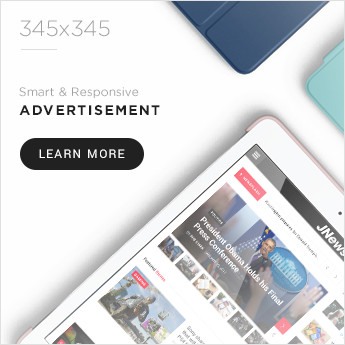Ganz schön gemein! So jedenfalls würde man heute auf manches der Experimente aus der Psychologie schauen. Viele Experimente wären ethisch nicht mehr vertretbar. Dennoch sind sie immer noch teils fester Bestandteil von Lehrbüchern und Studienheften. Gerne werden sie in Trainings als Argumentationshilfe herangezogen. Dabei sind sie umstritten, undifferenziert oder einseitig. Und oft nur zu verstehen im Kontext ihrer Zeit.
1. Das Stanford-Marshmallow-Experiment: Zurückhaltung zahlt sich eben nicht ein Leben lang aus
Ein vierjähriges Kind sitzt in einem Raum, vor ihm ein Marshmallow. Ein zweites süßes Zuckerstück in Sichtweite. Kann sich das Kind beherrschen? Wenn ja, so wird es erfolgreich sein. Wenn nein, eher nicht. Der Psychologe Walter Mischel wollte 1968-1974 herausfinden, inwieweit die Fähigkeit zur Selbstkontrolle sich auf das spätere Verhalten auswirkt. Würden die Kinder innehalten, den einen Marshmallow zu verspeisen, um einen zweiten später zu erhalten. Das nennt man Belohnungsaufschub.
2018 brachten Forscher um Tyler Watts von der New York University diese Erkenntnis ins Wanken. Sie untersuchten, inwieweit der Bildungsstand der Eltern mit dem Verhalten zu tun hat. „Von Kindergartenkindern meist gut ausgebildeter Eltern der Stanford-Universität auf den Rest der Welt zu schließen, sei nicht wirklich möglich.“
Vertiefung in diesem ZEIT-Artikel.
2. Little Albert-Experiment: Am Ende alles Show?
John B. Watson ist ein Name, der fest mit dem Behaviorismus verbunden ist. Vor allem das Experiment mit dem neun Monate alten Albert wird heute noch in verhaltenstherapeutischen Ausbildungen zitiert, und durchaus unkritisch. Als Absolventin kann ich das aus eigener Erfahrung sagen…
Das Experiment mit dem kleinen Albert ist immer noch als Video im Netz auffindbar und lässt uns erschaudern. Watson war übrigens ein Vorreiter autoritärer Erziehung. Watson hat das Experiment mit seiner Assistentin Rosalie Rayner durchgeführt, die er später ehelichte. Nach seinem Versuch flog er aus der Klinik und verdingte sich als Werbepsychologe.
Das Baby Albert wurde laut Watson ausgewählt, weil es zu Beginn des Experiments keine Angst vor Tieren hatte – auch nicht vor Ratten – und besonders gut entwickelt war. Er zeigte viel kindliche Neugier. Dann aber begann man ihn zu „konditionieren“. Seine Exposition mit der Ratte verbanden die Versuchsleiter mit einem lauten Geräusch, vor dem er schon zuvor Angst hatte. Am Ende zeigte Albert auch ohne diesen zweiten Reiz Furcht vor Ratten.
Tja, der kleine Albert wurde danach Jahrzehnte vergessen. Bis Historiker sich auf die Suche nach ihm begaben. Mit Sicherheit identifiziert werden konnte er nie. Klar ist aber: Dass uns auf diesem Experiment basierend die klassische Konditionierung beigebracht wurde: Ein absoluter „fail“.
Vertiefung in diesem Beitrag der Süddeutsche
3. Gedächtnisexperimente von Loftus: Wenn nichts wahr ist
Die noch lebende Elisabeth Loftus forscht ihr Leben lang über falsche Erinnerungen, die durch Suggestionen und Suggestivfragen verzerrt sind. Ihr „False-Memory-Syndrom“ besagt, dass eine Erinnerung so stark ist, als hätte sie stattgefunden. 1995 führte sie das berühmte „Lost-in-the-Mall“-Experiment durch. Den Teilnehmenden des Experimentes wurden vier Geschichten aus der eigenen Kindheit vorgelegt – auch falsche.
Sie wies nach, dass diese auch dann diese Geschichten glaubten, wenn sie nachweislich erfunden waren. Es war unmöglich zu unterscheiden, ob jemand etwas wirklich getan oder sich nur im Kopf ausgemalt hat. Das führte in der Kriminalistik zu einer Wende im Umgang mit Zeugenbefragungen und auch neuen Techniken.
Soweit so gut. Doch was ist wahr, wenn alles nur noch im Kopf stattfindet? Weil Loftus so sehr davon überzeugt war, dass sich Kopfgeburten nicht von realen Erlebnissen unterscheiden lassen, sagte sie vor Gericht auch immer wieder für Männer wie Bill Cosby oder Harvey Weinstein aus, denen Sexualdelikte vorgeworfen wurden und werden. Sie sagte auch als Sachverständige aus für eine Tochter, die den Vater wegen Missbrauchs beschuldigte.
Wenn aber alles immer nur im Kopf stattfinden kann, ist nichts mehr real. Wenn das dazu füjrt, dass am Ende dem wahren Geschehnis die Existenz abgesprochen wird? Schwierig.
4. Konformitätsexperiment von Asch: Wirklich so blind?
Würden Sie zugeben, etwas zu sehen, was sie nicht sehen? Der Asch-Effekt geht zurück auf ein Experiment von Solomon Asch aus dem Jahr 1951. Es wird bis heute immer wieder durchgeführt. Im Kern geht es darum, dass sich Menschen einer Mehrheitsmeinung anpassen, selbst wenn diese objektiv falsch ist.
Von der Versuchtsleitung instruierte Teilnehmende sollen die Länge einer Linie auf einem Blatt Papier angeben und vergleichen. Ihre Antwort ist absichtlich falsch. Die echten Teilnehmenden schlossen sich mehrheitlich diesen falschen Meinungen an. Dies vor allem auch dann, wenn sie die einzige Person in der Gruppe waren, die von der manipulierten Mehrheitsmeinung abwich.
Nun bringt uns dieses Experiment durchaus praxisrelevante Erkenntnisse, ist aber auch nicht ohne Weiteres auf die Realität zu übertragen.
In Aschs Experiment kennen sich die Menschen nicht. Hinzu kommt, dass unklar ist, ob sie am Ende wirklich glaubten falsch zu sehen oder sich einfach nicht die Mühe machen wollten, mit den anderen zu diskutieren. Außer Acht gelassen ist außerdem die Dynamik, die in einem längeren Prozess der Diskussion entstehen könnte…
Mehr zu diesem Experiment hier
5. Mann im schwarzen Sack: „Mehr davon“ wird nicht immer zur Gewöhnung
Stellen Sie sich vor, dass ein schwarzer Sack an Ihren Meetings teilnimmt. Gäbe es einen Aufschrei, Unruhe, Fragen? Wahrscheinlich würden Sie sich an den ungewöhnlichen Teilnehmer gewöhnen. Das jedenfalls besagt der Mere-Exposure-Effekt. Der Sozialpsychologe Charles Götzinger experimentierte 1968 mit einem in einen schwarzen Sack gekleideten Mann im Hörsaal. Erst stören sich die Studenten an dem seltsamen Gast, dann gewöhnen sie sich an ihn. Irgendwann läuft der Mensch im schwarzen Sack mit, als hätte er immer schon dazugehört. Die wiederholte Wahrnehmung von etwas führt zu einem Gewöhnungseffekt, ja „Must-Have“. Nun muss man Sachen von Menschen unterscheiden – und in beiden Fällen dürfte die Gewöhnung auch irgendwann in eine Übersättigung führen. Wir können uns auch sattsehen. Oder der Blick auf etwas, das dazu zu gehören schein, verändert sich. Also nicht ganz so einfach.
Fazit: Experimente und Erkenntnisse sind nur in ihrer Zeit zu verstehen. Sie beziehen sich meist auf einen Aspekt. Manche suggerieren einen Ursache-Wirkungszusammenhang, den es nicht gibt. Lassen Sie sich also keine Wahrheiten verkaufen. Und suchen Sie bei allem auch nach Gegenbeweisen.
Mehr Experimente aus der Sozialpsychologie kritischen beleuchtet bei Teamworks.
Der Beitrag 5 Psychoexperimente – und warum uns ihre Erkenntnisse in die Irre führen erschien zuerst auf Svenja Hofert.