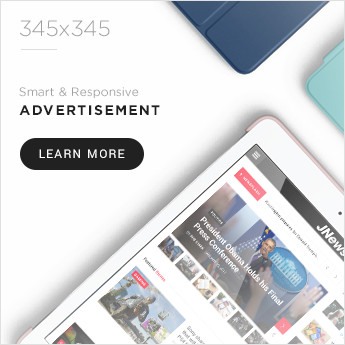Ich schreibe regelmäßig, seit ich 16 Jahre alt bin. An die Jahre zuvor kann ich mich zumindest nicht erinnern. Meine Mutter erzählte mir vor einiger Zeit, dass ich den Zauberlehrling mit 4 Jahren auswendig konnte. Ich liebte die Sprache also schon früh. Ich erinnere mich gut an meine Lieblingskassette, auf der auch Gedichte von Gottfried August Bürger und Theodor Fontane waren. Seitdem ist Schreiben – und das Nachdenken darüber – immer mehr Teil meines Lebens geworden. Einige Gedanken über das Schreiben und Nachdenken möchte ich hier teilen, wie in einem Tagebuch, das eigene Reflexion aber vielleicht auch Impulse liefert. Für wen, das weiß ich nicht.
13.3.2025
Über die Unzweckmäßigkeit
Seit langem wieder habe ich mit einem Studienfreund telefoniert. Nachdem wir auf dem neuesten Stand unserer Lebensentwürfe angekommen waren, sprachen wir über unsere Studienzeit. Sie war geprägt von einem Interesse, das die Frage nach Ziel oder Note ausließ. Es war vor der Bolognareform, es gab keine ECTS-Punkte. Zwar wurden die Hausarbeiten und Prüfungen bewertet, aber für den späteren Abschluss waren sie irrelevant. Mich erinnerte das an Kants „Kritik der Urteilskraft“ (1790), in der er anmerkt, dass wahre Kunst nicht primär einem praktischen Nutzen dient, sondern vielmehr für sich selbst existiert und als ästhetisches Erlebnis geschätzt wird. Nicht jeden Abschnitt, aber doch viele meines Studiums, kann ich in diesem Sinne beschreiben. Zwar nicht als bloße Rezeption des Schönen und Wahren, sondern in der Auseinandersetzung. Aber eben in einer Form der Ziellosigkeit, der Unzweckmäßigkeit, die es erst schafft, die oberen Schichten eines allzu naheliegenden Verständnisses abzuschaben. Ich habe es geliebt.
Gleichzeitig werde ich wehmütig, weil ich wahrnehme, dass Unzweckmäßigkeit sich verdächtig macht, dass Nutzen und Nützlichkeit geradezu unterstellt werden. Vielleicht bin ich schon angelangt in eben jener verklärenden Phase des Rückblicks, die man immer nur bei anderen vermutet. Dann wäre der Gedanke eine Sackgasse.